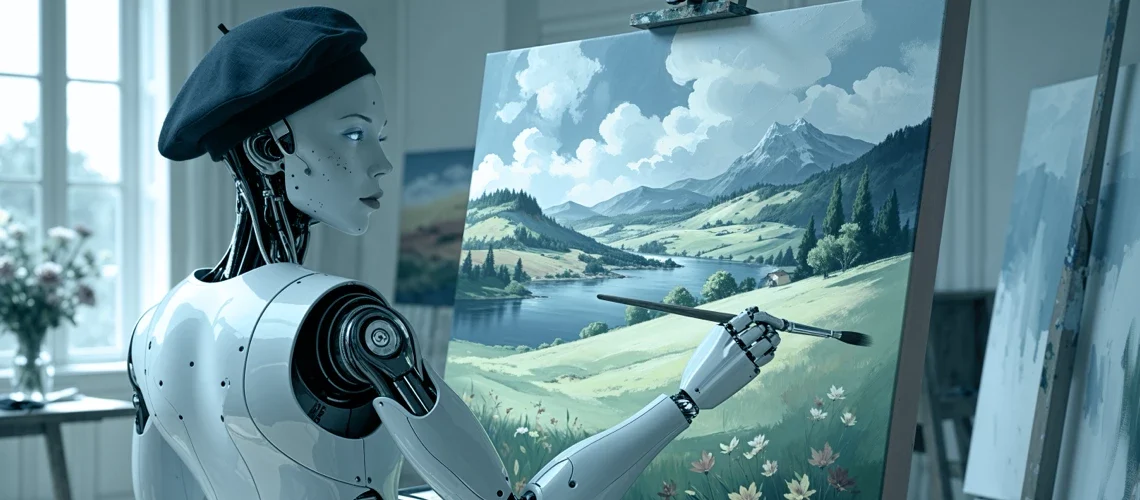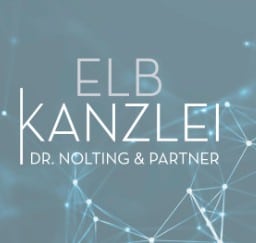Grundsatz: Nur ein Mensch kann Urheber sein
Nach deutschem Recht gilt: Urheber ist ausschließlich der Mensch, der das Werk erschaffen hat. Das Urheberrecht schützt dabei nur sogenannte persönliche geistige Schöpfungen – Werke, die durch individuelle menschliche Kreativität geprägt sind. Eine KI als solche besitzt keine Rechtsfähigkeit und kann somit kein Urheber sein. Nur wenn ein Mensch das Ergebnis der KI entscheidend prägt, etwa durch kreative Auswahl und Bearbeitung, kommt ein Schutz nach dem Urheberrechtsgesetz (UrhG) infrage [§ 7 UrhG, EuGH „Infopaq“].
KI als Werkzeug – Wie entsteht Schutz?
Nutzen Sie eine KI zur Unterstützung bei der Erstellung von Inhalten, entsteht ein urheberrechtlich geschütztes Werk nur dann, wenn Ihre persönliche geistige Schöpfung erkennbar bleibt. Entscheidend hierfür ist, dass Sie gezielt Einfluss auf das Ergebnis nehmen. Dazu gehören kreative Vorgaben, die Auswahl aus mehreren Varianten oder eine substanzielle Nachbearbeitung. Ein bloßes Eingeben eines simplen Prompts genügt in aller Regel nicht [BMJ-FAQ 2024].
Autonome KI-Ergebnisse – Freie Nutzung, aber Vorsicht geboten
Werden Inhalte vollständig autonom durch KI erzeugt, ohne entscheidenden menschlichen Einfluss, genießen diese keinen Urheberschutz. Sie gelten als gemeinfrei. Das bedeutet, dass sie grundsätzlich frei genutzt werden können. Jedoch sollten Unternehmer beachten, dass andere Rechtsgebiete weiterhin relevant sind, beispielsweise Marken- und Wettbewerbsrecht, Persönlichkeitsrecht oder auch Vertragsrecht. Prüfen Sie daher die Nutzung sorgfältig, insbesondere auf Ähnlichkeiten mit geschützten Werken oder Personen [BMJ-FAQ 2024].
Verwandte Schutzrechte bei Audio und Video
Selbst wenn rein KI-generierte Werke nicht urheberrechtlich geschützt sind, könnten sogenannte verwandte Schutzrechte greifen. Dazu zählen insbesondere Rechte des Tonträgerherstellers (§ 85 UrhG) und des Filmherstellers (§ 94 UrhG). Unternehmen, die Audio- oder Videoinhalte produzieren, sollten daher prüfen, ob diese Schutzrechte für sie relevant sein könnten.
Sonderregel Software und Quellcode
Für Computerprogramme gilt eine spezielle Regelung: Wenn ein Programm im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses erstellt wird, liegen die ausschließlichen Nutzungsrechte grundsätzlich beim Arbeitgeber (§ 69b UrhG). Wichtig ist, die kreative Mitwirkung der Entwickler zu dokumentieren, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden.
Fotorecht: Lichtbild vs. Lichtbildwerk
Im Fotorecht unterscheidet man zwischen Lichtbildwerken (§ 2 Abs. 1 Nr. 5 UrhG), die eine besondere kreative Qualität besitzen, und einfachen Lichtbildern (§ 72 UrhG), die nur einfache Fotografien darstellen. Auch einfache Fotos genießen einen eigenen Leistungsschutz. Unternehmen sollten deshalb klar zwischen diesen Kategorien unterscheiden, um den richtigen Schutzumfang zu bestimmen.
Text- und Data-Mining rechtlich sicher umsetzen
Die Nutzung von Daten zur automatisierten Analyse (Text- und Data-Mining, TDM) ist rechtlich geregelt: Die europäische DSM-Richtlinie erlaubt TDM grundsätzlich, sofern kein ausdrücklicher Opt-out-Hinweis der Rechteinhaber vorliegt (§ 44b UrhG). Unternehmen sollten daher sicherstellen, dass bei TDM-Vorhaben keine Rechte Dritter verletzt werden und Opt-outs konsequent respektiert werden [DSM-Richtlinie].
EU-AI-Verordnung: Transparenzpflichten kommen
Die kommende EU-KI-Verordnung (AI Act) wird neue Transparenzpflichten für KI-generierte Inhalte einführen. Insbesondere Inhalte, die synthetisch erzeugt wurden (z. B. Deepfakes), müssen entsprechend gekennzeichnet werden. Unternehmen sollten jetzt bereits geeignete Kennzeichnungs- und Dokumentationsverfahren etablieren, um späteren rechtlichen Verpflichtungen problemlos nachkommen zu können [AI Act 2024].
Praxistipps für Geschäftsführer:
- Klären Sie frühzeitig, wer in Ihrem Unternehmen die kreativen Entscheidungen trifft, wenn KI eingesetzt wird.
- Dokumentieren Sie sorgfältig jeden Schritt Ihres kreativen Prozesses.
- Stellen Sie klare interne Richtlinien auf, insbesondere zu TDM und zur Nutzung von KI-Inhalten.
- Prüfen Sie Lizenz- und Nutzungsbedingungen Ihrer KI-Tools und Lieferanten.
- Kontrollieren Sie KI-generierte Inhalte regelmäßig auf mögliche Rechtsverletzungen.
- Implementieren Sie bereits jetzt Prozesse zur Kennzeichnung von KI-generierten Inhalten gemäß der kommenden EU-Verordnung.
- Regeln Sie vertraglich klar die Nutzungsrechte und Verantwortlichkeiten mit Ihren Tool- und Lieferantenpartnern, insbesondere bezüglich Trainingsdaten, IP-Freistellungen, Audit-Rechte, Kennzeichnungspflichten und Rechteübertragung.
Entscheidungsdiagramm
Häufige Fragen (FAQ)
Ein einfaches Prompt genügt typischerweise nicht, um Urheberrechtsschutz zu begründen. Entscheidend ist, dass Ihre persönliche, kreative Leistung klar erkennbar ist. Dies umfasst beispielsweise umfangreiche Vorgaben, kreative Auswahlentscheidungen zwischen mehreren Vorschlägen und gezielte Bearbeitungsschritte am Endergebnis. Je mehr eigene, kreative Einflussnahme dokumentiert werden kann, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Ergebnis als persönliche geistige Schöpfung urheberrechtlich geschützt ist.
Rein KI-generierte Werke sind in der Regel nicht durch das Urheberrecht geschützt und somit gemeinfrei. Allerdings sollten Unternehmen beachten, dass andere Schutzrechte bestehen bleiben können, darunter Marken-, Wettbewerbs- oder Persönlichkeitsrechte. Es ist wichtig, KI-generierte Inhalte sorgfältig daraufhin zu prüfen, ob diese möglicherweise Rechte Dritter verletzen könnten. Eine gründliche rechtliche Prüfung minimiert das Risiko teurer Rechtsstreitigkeiten erheblich.
Die Rechte an KI-generierten Inhalten aus Online-Tools hängen maßgeblich von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des jeweiligen Anbieters ab. Oftmals behalten sich Anbieter gewisse Nutzungsrechte vor oder beschränken Ihre Nutzungsmöglichkeiten, insbesondere im kommerziellen Bereich. Es ist daher essenziell, die AGB genau zu prüfen und sicherzustellen, dass Sie über die notwendigen Nutzungsrechte verfügen. Bei Unklarheiten sollte rechtlicher Rat eingeholt werden, um spätere Konflikte zu vermeiden.
Sind KI-Ergebnisse bestehenden geschützten Werken zu ähnlich, kann dies eine Verletzung des Urheberrechts darstellen. Entscheidend ist, ob der KI-Output eine ausreichende schöpferische Distanz zum Originalwerk aufweist. Ist dies nicht der Fall, könnte die Nutzung gegen Urheberrechte verstoßen und entsprechende Ansprüche wie Unterlassung und Schadensersatz auslösen. Daher sollten Unternehmen KI-Ergebnisse sorgfältig auf eine mögliche Ähnlichkeit zu geschützten Werken überprüfen und im Zweifel rechtlich prüfen lassen.
Die Nutzung von KI-generiertem Code, der Teilen von GPL-lizenziertem Code ähnelt, sollte mit größter Vorsicht erfolgen. GPL-Lizenzen enthalten strenge Vorgaben (Copyleft), die verlangen, dass daraus abgeleitete Software ebenfalls unter GPL veröffentlicht werden muss. Stellt sich heraus, dass Ihr KI-generierter Code substanziell GPL-Code enthält oder davon abgeleitet ist, sind Sie verpflichtet, Ihre Software ebenfalls offen zu legen. Dies könnte erhebliche Auswirkungen auf Ihre Geschäftsstrategie haben. Lassen Sie daher jeden KI-generierten Code genau prüfen, bevor Sie ihn produktiv einsetzen.
KI eröffnet viele Chancen, birgt aber auch rechtliche Herausforderungen. Unternehmer sollten rechtzeitig Maßnahmen treffen, um Risiken zu minimieren. Sprechen Sie mit uns, um Ihr Unternehmen bestmöglich abzusichern.
ELBKANZLEI Fachanwälte stehen für:
- Kompetenz, Erfahrung, Präzision und Umsicht im Urheberrecht.
- Feste Ansprechpartner pro Mandat.
- Leistungsstarke und zielgerichtete Mandatsbearbeitung.
- Faire, transparente Honorare.
Bei Bedarf hören wir gern von Ihnen.